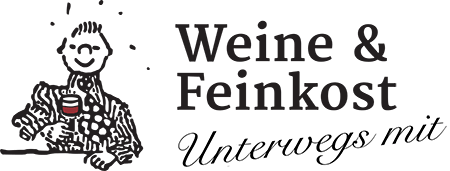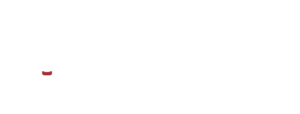Trinklieder
Trinklieder sind wahrscheinlich so alt wie der Konsum alkoholischer Getränke selbst. Dieser Konstante des menschlichen Handelns, mit vom Gersten- oder Rebensaft gelöster Zunge seiner Lebensfreude lauthals Luft zu machen und mehr oder weniger melodisch in die Kneipe oder den Biergarten hinein zu trällern, verdanken wir einen großen Fundus von mal feierlichen, mal zügellosen, mal nachdenklichen und mal lustigen Weisen. An dieser Stelle wollen wir uns aber nicht zotigen Mallorca-Schlagern widmen, sondern sozusagen der Hochkultur dieser Disziplin – doch keine Sorge, diese fällt oft nicht weniger derb aus.
In früheren Jahrhunderten waren Trinklieder oft nur auf ihre jeweiligen Herkunftsregionen und deren Dialekte beschränkt, die meisten davon sind uns leider nicht überliefert. Erst im 18. Jahrhundert begann man damit, dieser Art von Liedern einen höheren kulturellen Wert beizumessen, sie niederzuschreiben und zu vervielfältigen. Dieser Umstand hatte den Vorteil, dass bestimmte Lieder eine sehr große Reichweite erlangten, weil der Reisende aus Hamburg nun auch in Frankfurt mit einstimmen konnte – eine Art früher Kulturindustrie war geboren.
Und einer derjenigen, die diese Industrie regelmäßig mit neuen Gassenhauern versorgte, war Joseph Victor von Scheffel. Der badische Dichter war in seiner Studienzeit Mitglied in einigen Studentenverbindungen geworden und kannte daher das Bedürfnis, zu später Stunde, den schäumenden Humpen in der Hand, in den verwinkelten Gassen der altehrwürdigen Universitätsstädte ein Liedchen anzustimmen. Die Grenzen zwischen schwärmerischer Volksweise, erzählender Ballade und anzüglichem Trinklied sind oft fließend, und so ließ sich Scheffel häufig von lokalen Kuriositäten inspirieren.
Eine solche ist der Hintergrund seines Liedes „Das war der Zwerg Perkeo“. Besagte Figur gab es tatsächlich, er war in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Hofzwerg des Kurfürsten von der Pfalz. Seine Größe ist uns mit nur drei Fuß und sechs Zoll überliefert, was umgerechnet etwa 1,07 Meter sind, sein Gewicht soll dafür bei 100 Kilo gelegen haben. Und auch wenn es uns heute befremdlich erscheinen mag, dass sich ein Herrscher einen Kleinwüchsigen zur Belustigung hält, war Perkeo aufgrund seines schlagfertigen Mundwerks, besonders aber seiner schier unfassbaren Trinkfestigkeit ein hochgeschätzter Mann bei Hofe. Fünfzehn Magumflaschen soll er täglich geleert haben, und brachte er das mal nicht fertig, wurde er der Überlieferung zufolge mit der Peitsche dafür bestraft. Auch wenn sowohl die Menge des Weines als auch das Ausmaß der Züchtigung als übertrieben gelten können, müssen wir wohl annehmen, dass Perkeos Konsum nicht besonders leberschonend war: schon mit Anfang 30 verstarb er. Der Kurfürst war darüber so betrübt, dass er dem kleinen Kerl ein Denkmal setzen ließ, das man auch heute noch besichtigen kann: es bewacht wie schon seine lebendige Vorlage das Riesenfass im Heidelberger Schloss.
Diese gigantische Holzkonstruktion mit über 200 000 Litern Fassungsvermögen diente dazu, die Weinabgaben der dem Kurfürsten untertänigen Bauern zu verwahren. Zwar trugen Schäden an der das Fass umgebenden Bausubstanz, hygienische Bedenken und auch die Schwierigkeit, das riesige Behältnis dauerhaft dicht zu halten, dazu bei, dass es die meiste Zeit nicht gefüllt war, dennoch spielte es als Kuriosum, das man stolz hohen Gästen präsentieren konnte, eine wichtige Rolle bei Hofe.
Das Verhältnis zwischen diesem Fass und Perkeo beschreibt Scheffel zwischen Ironie und Tragik pendelnd, aber immer mit einer augenzwinkernden Bewunderung für dessen Mission: „Beim Weinschlürf sonder End erklär ich alter Narre fortan mich permanent.“ 15 Jahre lang soll er gegen das Fass angekämpft und schließlich gesiegt haben, wenn auch um den Preis seines jungen Lebens. Wir erfahren sogar, womit Perkeo es sich hat gutgehen lassen: rheinischer Malvasier soll der Inhalt des Fasses gewesen sein. Obwohl diese Rebsorte in Deutschland mit Ausnahme einiger weniger Weingüter in Rheinhessen heutzutage fast nicht mehr angebaut wird, sondern hauptsächlich im Mittelmeerraum wächst, ist es sogar durchaus möglich, dass der Zwerg damals davon trank. Im Mittelalter und der Frühen Neuzeit war das Klima hierzulande deutlich milder; so ist belegt, dass Martin Luther ihn sehr schätzte und er als ausgemachte kulinarische Kostbarkeit an vielen Adelshöfen aufgetischt wurde. Der hohe Restzuckeranteil des schweren, meist süß ausgebauten Dessertweins würde immerhin erklären, wie Perkeo zu seiner Leibesfülle kam.
Und der Fortgang des Liedes, was es eigentlich mit seinem „Künstlernamen“ auf sich hat: als gebürtiger Südtiroler war er des Italienischen mächtig und erwiderte auf die häufigen hämischen Fragen der Gäste, ob er denn das Riesenfass ganz austrinken könne, irgendwann nur noch „Perché no?“ – „Warum nicht?“ Damit nahm das Schicksal seinen Lauf – wie „David gegen Goliath“ beschreibt Scheffel den stoischen Kampf Perkeos: „Da sprach er fromm: ,Nun preiset, Ihr Leut’, des Herren Macht, die in mir schwachem Knirpse so Starkes hat vollbracht’“ – bevor er neben dem Fass heldenhaft dahinscheidet. Allen Neugierigen, welche die Gruft des tapferen Perkeo besuchen wollen, gibt der Autor denn auch noch eine Warnung mit: „Und wer als frommer Pilger frühmorgens ihr genaht: Weh ihm! Als Weinvertilger durchtobt er nachts die Stadt!“
Überhaupt scheinen die Dichter ihre Leser nicht wenig vor den Gefahren allzu exzessiven Weingenusses zu warnen. So etwa auch im „Grafen von Rüdesheim“, unserem nächsten Lied. Schon der namensgebende Ort steht mit dem Niederwalddenkmal, die vielen Burgruinen und natürlich dem Weinbau für Rheinromantik, die sicherlich auch die beiden Freunde Ernst Bloch und Albert Georg Benda verspürt haben dürften, als sie 1875 während eines Pfingstausfluges dort einkehrten und gemeinsam den Text verfassten. In diesem geht es um besagten Grafen, der zwar nicht wirklich existierte, der zwei jungen Männern, die genau wie die von ihnen erdachte Figur wahrscheinlich unglücklich verliebt, notorisch klamm und sehr durstig waren, aber wohl wie aus dem echten Leben gegriffen erschien.
Dabei ist die Ausgangslage für den Grafen eigentlich nicht schlecht: als „mit Gütern reich beglückt“ wird er beschrieben, eine gute Partie in jedem Fall. Doch direkt in der ersten Strophe nimmt das Unheil seinen Lauf, weil er ein Auge auf eine Winzertochter geworfen hat, die von seinen Avancen so rein gar nichts wissen will – ein ziemlicher Affront in der damaligen Zeit. Der Graf wird dadurch aber nicht etwa angespornt oder wütend, sondern verfällt in Schwermut und igelt sich in seiner Burg ein, wo er sich fortan nur noch dem Weintrinken widmet: „Und er saß und vergaß in seiner Burg am Rheine, seinen Schmerz, denn das Herz tröstet Rüdesheimer Wein!“ heißt es darum im Refrain. Depressionen mit Suchtverhalten bekämpfen? Im 19. Jahrhundert durchaus gentleman-like. Als wenn das nicht schon traurig genug wäre, wird im Laufe der Zeit auch seine finanzielle Lage immer prekärer. Nach sieben Jahren hat er seinen ganzen stattlichen Besitz, immerhin „wohl 40 Güter“, versoffen. Er muss seine Stammburg verlassen und fortan im Stand eines einfachen Knechtes leben, der für wenig Geld hart schuftet – im Wirtshaus an der Burg, wo er am Sonntag den Lohn seiner Woche wieder in Wein umsetzt.
Beim Singen dieses Liedes, das, wie auch die anderen hier vorgestellten Werke, seine Verbreitung dem in fast 170 Auflagen erschienenen Allgemeinen Deutschen Kommersbuch verdankt, der Sammlung studentischen Liedgutes, ist es oft üblich, dass man sich während des Refrains mit seinen Sitznachbarn unterhakt und gemeinsam mit ihnen schunkelt – so weit, so wenig spektakulär. Doch halt – beim ersten Mal geschieht das noch im Sitzen, beim zweiten schon im Stehen, beim dritten auf den Stühlen und beim vierten Mal dann auf den Tischen. Das kann, angeheitert und zu später Stunde, schon mal eine recht wacklige Angelegenheit sein, wenn nicht die diversen Schutzheiligen der Trinker ihre Hand über die ihnen Anvertrauten halten würden.
Um ebendiese geht es in unserem dritten Gassenhauer. „Wohlauf, die Luft geht frisch und rein“ als reines Trinklied zu bezeichnen, würde ihm sicherlich nicht gerecht werden, schließlich gilt das auch als „Frankenlied“ bekannte Werk nach wie vor als inoffizielle Landeshymne Frankens, mit dem man sich gern gegen die ungeliebten Bayern abgrenzt, denen man ja immerhin auch einen florierenden Weinbau voraus hat. Den Text hat hier wieder mal Joseph von Scheffel verfasst, und ebenso wie er im Sommer 1859 ist das lyrische Ich auf Wanderschaft in der Gegend südlich von Coburg. Bei bestem Wetter zieht dieses als Scholar, als fahrender Schüler, durch die Landschaft und preist das ländliche Idyll. „Bald hebt sich auch das Herbsten an, die Kelter harrt des Weines. Der Winzer Schutzherr Kilian beschert uns etwas Feines!“ stellt er fest, obwohl für eine gute Weinlese mitnichten der irische Wanderprediger Kilian zuständig ist, der im frühen Mittelalter in der Würzburger Gegend missionierte und deswegen als einer der Patrone Frankens gilt, sondern viel eher der heilige Bischof Urban, der deswegen meist mit dem Weinstock in der Hand abgebildet wird, hinter dem er sich der Legende zufolge vor seinen Häschern versteckt haben soll.
Der Weg des Scholaren führt in am Main entlang nach Staffelstein, hier will er dem „Einsiedelmann“ einen Besuch abstatten. Gemeint ist damit ziemlich sicher der Eremit Ivo Hennemann, der 40 Jahre lang abgeschieden in einer Klause neben der dortigen Kapelle lebte, in der Tradition der frommen Männer, die sich dort schon seit 1700 ganz dem Dienst an Gott verschrieben hatten. Im Lied wird er jedoch als recht weltoffen präsentiert, er unterhält sich angeregt mit einer hübschen Schnitterin, also einer Frau, die mit der Heuernte beschäftigt ist. Seinem unerwarteten Gast dauert dieser Plausch jedoch viel zu lang, er verspürt nach dem anstrengenden Fußmarsch Lust auf eine Erfrischung aus dem Weinkeller des Einsiedlers, in dem er gute Jahrgänge vermutet. „Hoiho, die Pforten brech’ ich ein und trinke, was ich finde“, verschafft er sich auf rabiate Art und Weise selbst Zugang und bittet gleichzeitig: „Du heil’ger Veit von Staffelstein, verzeih mir Durst und Sünde.“ Wie der Einsiedelmann auf dieses forsche Vorgehen reagiert, überlässt Scheffel dann aber der Fantasie.
Um Wein im weiteren Sinne geht es auch im „Krambambuli“. Dass das Lied heutzutage gern im Winter anlässlich der Feuerzangenbowle gesungen wird, ist eigentlich ein Missverständnis. Denn obwohl besonders im österreichischen Raum beide Begriffe mittlerweile synonym verwendet werden, bezeichnete Krambambuli ursprünglich nicht den heißen Punsch mit durch brennenden Rum karamellisiertem Zucker, sondern eine Branntweinspirituose aus Pommern, die dort Mitte des 18. Jahrhunderts in der Brennerei „Lachs zu Danzig“ hergestellt wurde, just zu der Zeit, als der Hofrat Christoph Friedrich Wedekind das Lied niederschrieb. Den seltsam anmutenden Namen verdankt der Schnaps einer Kombination aus dem niederdeutschen „Krandewitt“ für Wacholder und dem aus der Gaunersprache stammenden Begriff „Blamp“ für Alkohol.
Dass dieser sehr frühe Werbesong für ein ganz bestimmtes Produkt auch auf andere geistreiche Getränke ausgeweitet wurde, ist der funkelnd roten Farbe geschuldet, die der Krambambuli etwa mit der Feuerzangenbowle gemein hat. Und auch die Wirkung scheint vergleichbar gewesen zu sein, wird doch der Schnaps als Heilmittel für alle möglichen Leiden angepriesen. Körperliche Gebrechen stehen natürlich an erster Stelle: „Reißt mich’s im Kopf, reißt mich’s im Magen, hab ich zum Essen keine Lust, wenn mich die bösen Schnupfen plagen, hab ich Katarrh auf meiner Brust.“ Aber auch seelische oder finanzielle Probleme scheinen sich durch den Genuss kurieren zu lassen: „Ist mir mein Wechsel ausgeblieben, hat mich das Spiel auch arm gemacht, hat mir mein Mädchen nicht geschrieben, ein’n Trauerbrief die Post gebracht“. Dem bieder-beschwingten Anfang einer jeden Strophe folgt stets ein sehr schneller, stakkatoartigen Ausklang, der seinen Höhepunkt im feierlichen „Krambimbambambuli, Krambambuli!“ findet. Auch Erfolg in der Liebe oder ein gutes Überstehen der Militärzeit wird versprochen, sich nebenbei über die zur damaligen Zeit schwer in Mode geratenen Trinkkuren in „Pyrmont und Schwalbach“ lustig gemacht, die mit ihrer „mineralischen Brüh’“, von denen die Kurgäste täglich bis zu 20 Liter trinken mussten, doch keine Chance gegen den Schnaps hätten. Neben einem solchen kulturhistorisch interessanten Überblick über die damaligen neuesten Errungenschaften – etwa die Elektrizität, Chemie oder Kosmetik -, deren Wert und Nutzen gegen den des Krambambuli abgewogen wird, stehen auch gänzlich absurde Strophen, die beschreiben, wie er in den Kolonien und der Neuen Welt – „da wo die wilden Kaffers wohnen“ – als Heiligtum verehrt werden würde. Wem das heutzutage zu anstößig erscheint, wähle sich stattdessen einfach eine andere aus den über 100 Strophen, auf die das Lied im Laufe der Zeit von lyrisch versierten Sängern aufgestockt wurde.
Und jetzt angestimmt! Ob man nun mit dem Grafen von Rüdesheim leiden, mit dem fahrenden Scholaren der Natur ein Ständchen bringen oder mit dem Zwerg Perkeo zu ganz und gar abenteuerlichen Schandtaten aufbrechen will – wenn jemand zufällig Klavier oder Akkordeon dazu spielen kann, umso besser. Auch wenn die Melodien etwa des Frankenliedes zunächst nicht ganz einfach zu singen scheinen mögen, sei aus eigener Erfahrung versichert, dass sich dieses Problem nach einigen Gläsern Rüdesheimer Wein oder rheinischen Malvasier von selbst löst. Text: Dario Sellmeier