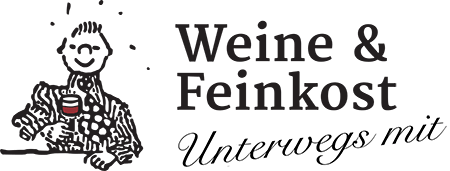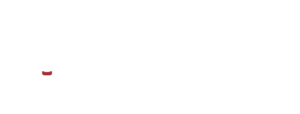Krimsekt: Zwischen Tradition, Politik und der Suche nach Identität
Champagner aus Osteuropa? Das ist eigentlich unmöglich, denn die Herkunftsangabe des wohl bekanntesten französischen Exportproduktes ist streng geschützt. Nein, es hängt eher damit zusammen, dass im Russischen landläufig jede Art von Schaumwein schlicht als „schampanskoje“ bezeichnet wird. Ironischerweise soll das für den „echten“ Schampus seit 2021 nicht mehr gelten: Moskau verfügte jüngst, dass alle ausländischen Importe nur noch als „igristoje vino“ zu bezeichnen sind, während die Bezeichnung „schampanskoje“ allein russischen Erzeugnissen vorbehalten ist. Die Franzosen tobten, sahen sich in ihrer Ehre verletzt, drohten mit Handelsboykott – allein, es half nichts. Nun darf tatsächlich mit Fug und Recht bezweifelt werden, dass eine „russische Straßenrandrebe“, wie ein wütender Kommentator nach der Entscheidung in der Presse polemisierte, mit den edlen Gewächsen rund um Reims mithalten kann. Und dennoch ist es durchaus spannend, sich einmal in die Geschichte osteuropäischen Schaumweines zu vertiefen. Denn Krimsekt ist, seine Qualität hin oder her, auch über 30 Jahre nach dem Untergang der Sowjetunion immer noch ein Produkt, dass zahlreiche Assoziationen weckt: vom Kampf Ost gegen West, zaristischer ebenso wie stalinistischer Dekadenz, von Erfindungsreichtum und Pioniergeist, von Minderwertigkeitskomplexen und Größenwahn. Und nicht zuletzt berührt man angesichts der aktuellen geopolitischen Ereignisse auch noch eine weitere Frage: wem gehört denn nun der Krimsekt, von dem jährlich immerhin 50 Millionen Flaschen in alle Welt exportiert werden? Den Russen oder den Ukrainern?
Aber beginnen wir von vorn. Durch seine Lage an der europäischen Peripherie waren russischer Adel und insbesondere der Zarenhof seit jeher darauf bedacht, die aktuellen Moden aus dem Herzen des Kontinents zu sich zu holen, um nicht nur nicht den Anschluss zu verlieren, sondern geradezu auf dem allerneuesten Stand zu sein. Und um die Mitte des 18. Jahrhunderts lag das Epizentrum der höfischen Kultur in Versailles. Alles, was man dort an Kleidung trug, an Romanen las oder an Architektur bewunderte, galt auch in Russland als der letzte Schrei. Ebenso verhielt es sich mit Kulinarik: das Getränk der herrschenden Klasse schlechthin war Champagner. Sich diesen direkt aus Frankreich schicken zu lassen, das konnte sich zwar der Hochadel leisten, die zahlreichen weniger begüterten Landadligen allerdings blieben außen vor – wollten aber natürlich auf diese Art der Repräsentation nicht verzichten. Also begann man damit, Schaumwein auch in Russland herzustellen. Zunächst noch nicht auf der Krim, die zu dieser Zeit gar nicht Teil des Reiches war, sondern am Unterlauf des Don. Der rote Perlwein, hergestellt auf vergleichsweise primitive Art und vermarktet unter dem Namen „Zimljanskoje“, kam gut an, war geschmacklich aber meilenweit vom Original entfernt. Doch der Grundstein war gelegt und es dauerte nicht lange, bis das noch recht junge Herrscherhaus der Romanows das Prestige erkannte, welches eine heimische Sektindustrie bieten könnte.
Eine große Chance eröffnete sich, als unter Katharina der Großen die Osmanen die Krim abtreten mussten. Schnell avancierte die Halbinsel am Schwarzen Meer dank ihrer pittoresken Küstenlandschaften und des für russische Verhältnisse sehr milden Klimas zum beliebten Ziel für Reiselustige. Die zeigten sich allerdings wenig zufrieden mit der Infrastruktur vor Ort – Landwirtschaft, Straßenbau und Verwaltung waren von den ansässigen Krimtartaren kaum gepflegt worden. Also schickte Zarin Katharina ihr Multitalent Fürst Potjomkin, um für ein wenig Ordnung zu sorgen. Ob es daran lag, dass er nebenbei auch ihr Liebhaber war, kann nur gemutmaßt werden, jedenfalls wusste der Fürst recht genau Bescheid über die Ambitionen Katharinas, ihr Land in der Weinwelt zu einer echten Nummer zu machen. Aus ganz Europa ließ er Rebstöcke heranschaffen und in die gerade erst urbar gemachte Erde setzen, wobei er klugerweise darauf achtete, solche aus klimatisch ähnlichen Verhältnissen auszuwählen. Besonders erfolgreich war er damit zwar nicht – insbesondere die klassischen Champagner-Reben fühlten sich auf der Krim nicht wohl -, kann aber dennoch als der Erste gelten, der dort auf professionelle Weise wieder Weinbau betrieb, seitdem der mächtige Seefahrer-Stadtstaat Genua einige hundert Jahre zuvor seinen Einfluss dort verloren hatte.
Katharina wollte die Angelegenheit nun in professionelle Hände geben. Selbst gebürtige Deutsche und der Mode folgend, die sich an den im Zuge der Französischen Revolution stark erkalteten Frankreich-Hype anschloss – nämlich militärische und wissenschaftliche Posten bevorzugt mit Deutschen zu besetzen -, engagierte sie den preußischen Naturforscher Peter Simon Pallas. Der erkor schnell den optimalen Standort aus: die Städte Aluschta und Sudak im Südosten sollten es sein, die fruchtbaren Böden und Sonnenschein an vier von fünf Tagen hatten ihn überzeugt. Anders als sein Vorgänger setzte sich Pallas nicht nur mit den Anbaumöglichkeiten etablierter europäischer Reben auseinander, sondern bezog in seine wissenschaftlichen Untersuchungen auch etwa drei Dutzend auf der Krim heimische Sorten mit ein – damals ein geradezu unerhörtes Novum. In Feodossija entstand die erste Weinkeltereischule und im Jahre 1799 war es dann so weit: der erste auf der Krim erzeugte Schaumwein erblickte das Licht der Welt – und wurde direkt exklusiv nach Sankt Petersburg an den Zarenhof geschickt. Ob Pallas nun in dessen Qualität selbst oder aber in die Bereitschaft der Russen, Sekt aus dem eigenen Land zu erwerben, kein Vertrauen hatte, ist nicht überliefert – jedenfalls fand nach anfänglichen Erfolgen seine Karriere in Russland ein jähes Ende, als sich herausstellte, dass er Krim-Weine ganz stumpf mit französischen Etiketten versehen hatte, um sie besser verkaufen zu können.
Die Russen lernten aus diesem unappetitlichen Vorfall und beschlossen, fortan nur noch Landsleute mit dem Projekt zu betrauen. Im 19. Jahrhundert taten sich bei den Versuchen, weintechnisch in die erste Liga aufzusteigen, zwei Männer besonders hervor: der erste war Michail Woronzow, ein verdienter Offizier, der als Generalgouverneur von Neurussland, wie das Gebiet aus Krim und Süd- und Ostukraine damals genannt wurde, wichtige Modernisierungsmaßnahmen in dem damals kaum besiedelten Landstrich anstieß und es in dieser Hinsicht vor allem verstand, statt der nur widerwillig fließenden Staatsmittel das Geld privater Investoren zu akquirieren. 1820 erwarb er in Jalta große Flächen für ein Weingut, das sich zu einem wahren Musterbetrieb entwickelte: Woronzow wusste nämlich die hohe Arbeitsmoral aus anderen Teilen Russlands vor ihren Herren geflohener Leibeigener für sich zu nutzen, indem er sie nicht verfolgen und zurückbringen ließ, sondern wie freie Lohnarbeiter behandelte. Fast 200 Jahre alt ist außerdem das durch ihn begründete und noch immer bestehende Weinbauinstitut Magarach, heutzutage das mit der zweitgrößten Rebenvielfalt in Europa. Die meisten anderen seiner Anstrengungen hingegen wurden während des Krimkrieges in den 1850er Jahren zunichte gemacht. Für diese militärische Intervention, mit der Osmanisches Reich, Großbritannien und Frankreich die russischen Expansionsbestrebungen zurückdrängen wollten, sollte sich ein zweiter Mann allerdings ein halbes Jahrhundert später auf sehr subtile Weise rächen…
Fürst Lew Golitzin war als vermögender und sehr belesener Adliger viel in der Welt herumgekommen – insbesondere Frankreich hatte es ihm angetan, wo er sich mit Techniken des Weinbaus vertraut machte. 1878 gründete er sein eigenes Weingut unter dem poetischen Namen Nowyj Swet – „Neue Welt“ – und erschuf geschmacklich tatsächlich eine ebensolche, denn er ging den Weinbau direkt in riesengroßem Maßstab an und ermöglichte damit Produktionsmengen, die sich kommerziell vermarkten ließen. Zu dieser Zeit war die Herstellung des Schaumweines von der Schwarzmeerküste weitestgehend professionalisiert: es gab zum einen einen meist trockenen weißen aus den Rebsorten Chardonnay, Grauburgunder, Riesling und Aligoté sowie einen deutlich beliebteren roten aus Merlot, Cabernet Sauvignon, Saperavi und Matrassa. Letzterer präsentiert sich je nach Qualität und Vorlieben leicht bis nahezu unerträglich süß und ist meistens gemeint, wenn von Krimsekt die Rede ist. Zum anderen hatte sich aber nach vielem nicht zufriedenstellendem Herumprobieren auch die Champagner-Methode etabliert: nach konventioneller Herstellung der Grundweine wurden diese zusammen mit Zucker und Hefe in Flaschen gefüllt. Neun Monate beim weißen, beim roten Krimsekt bis zu einem Jahr vollzog sich nun die Gärung, dann wurde die Hefe abgerüttelt, durch Degorgieren entfernt und der Verlust an Inhalt durch Zugabe der Dosage ausgeglichen. Alles lehrbuchmäßig französisch.
Umso größer war die Empörung der französischen Weinbauern auf der Weltausstellung in Paris im Jahre 1900, als Golitzins Krimsekt völlig unerwartet den Grand Prix der internationalen Jury gewann: die Russen hatten nicht nur dreist die Herstellungsweise kopiert, sondern auch noch durchschlagenden Erfolg damit! Anfang des 20. Jahrhunderts war der russische Schaumwein endlich am Ziel: weltweite Anerkennung war ihm gewiss, die sich schon bald in astronomischen Preisen manifestierte, die jene der klassischen Champagner-Häuser in den Schatten stellten. Während deren Erzeugnisse längst zur Selbstverständlichkeit auch im gehobenen Bürgertum geworden waren, galt der Krimsekt als geradezu mythisches Getränk, das in der Vorstellung der Europäer vom Zaren allein aus edelsteinbesetzten Kelchen genossen wurde. Ironischerweise war es Fürst Golitzin, der vom Hype um „sein“ Getränk am wenigsten profitierte: seine an sich lobenswerte Philosophie, jeder Russe solle unabhängig von seinen finanziellen Mitteln in der Lage sein, guten Wein zu trinken, führte ihn schließlich in den Ruin. Sein Geschäft in Moskau wurde Tag und Nacht von zechwütigen Studenten belagert, die sich mit dem hochwertigen, aber zu spottbilligen, keineswegs kostendeckenden Preisen angebotenen Schaumwein auf offener Straße betranken.
Das goldene Zeitalter dauerte aber nicht mal anderthalb Jahrzehnte, dann brach der Erste Weltkrieg über den Kontinent herein. Der Zar verbot 1914 die Herstellung, da Schaumwein nicht als kriegsnotwendiges Lebensmittel galt und Alkoholkonsum die Moral der Truppen zu schwächen drohte. Ein in Krisenzeiten demonstrativer Verzicht auf Luxus, denn das war Krimsekt zu dieser Zeit noch immer, dürfte für den weltfremden Nikolaus II. hingegen kaum eine Rolle gespielt haben. Erst mit Lenins Tod endete der Bann, dann aber ging es so richtig los: Stalin sah nicht ein, das Getränk der Bourgeoisie zuzurechnen und damit der ideologischen Verdammnis anheimfallen zu lassen, sondern schaffte es in den 30ern zum ersten Mal, es tatsächlich in großen Mengen herzustellen – was freilich zulasten der Qualität ging, da man statt langwieriger Flaschengärung jetzt auf spezielle Tanks setzte, in denen der Wein nur noch einen Monat verblieb. Und einem Großteil der Bevölkerung immer noch nichts nützte, da diese durch kommunistische Misswirtschaft nun selbst für diesen historisch günstigen Krimsekt zu arm war.
Nachdem der Zweite Weltkrieg das Sekttrinken ohnehin für einige Jahre obsolet gemacht hatte, startete man in den 50ern eine neue Offensive – allerdings unter anderen Vorzeichen. Die Menschen sollten nicht mehr in den Genuss von einst dem Adel vorbehaltenen Gütern kommen, sondern im Sinne einer hilflosen Ernährungspädagogik hauptsächlich dazu gebracht werden, vom weit verbreiteten hochprozentigen Wodka auf den weniger alkoholischen Schaumwein umzusteigen und sich zumindest etwas langsamer zugrunde zu richten. Zu dieser Zeit galt die Sowjetunion als drittgrößter Weinproduzent der Welt – und während das im Inland nur wenig gewürdigt wurde, setzte eine schleichende internationale Popularität ein, die sich nicht nur auf die Reichen und Schönen erstreckte, sondern geradezu Teil der Popkultur wurde. Hatten 150 Jahre zuvor russische Dichter wie Puschkin in ihren Werken die französischen Champagner gelobt, waren es nun Franzosen wie Gilbert Bécaud mit seinem Chanson „Nathalie“ und Deutsche wie die Gruppe Dschingis Khan mit ihrem Schlager „Moskau“, die dem Krimsekt musikalische Denkmäler setzten. In der Nachkriegszeit mit ihrem Verlangen nach unkomplizierten, süßen Weinen schlug der Sowjet-Sprudel ein wie eine Bombe und war im Westen wahrscheinlich eines der beliebtesten Produkte überhaupt von jenseits des Eisernen Vorhangs. Ausgerechnet der große Reformer Michail Gorbatschow war es, der im Zuge von Glasnost und Perestroika dem Krimsekt fast den Todesstoß versetzt hätte: angesichts der gigantischen Ausmaße, die der Alkoholismus aufgrund der Perspektivlosigkeit innerhalb der russischen Bevölkerung angenommen hatte, ließ er in den 80er Jahren gnadenlos Weinberge roden und dezimierte etwa die Anbaufläche in der Ukrainischen SSR um zwei Drittel. Womit wir wieder bei der Ukraine angelangt wären. Erst mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde sie – und mit ihr die Krim – ein souveräner Staat. Im knappen Vierteljahrhundert, das folgen sollte, bis Russland die Halbinsel annektierte, blieb nicht viel Zeit, um einem urrussischen Produkt wie dem Krimsekt ein ukrainisches Image zu verleihen.
Zugute kommt der Ukraine da, dass dieser – anders als etwa Champagner – keine geschützte Herkunftsbezeichnung ist und deshalb auch in anderen Gebieten erzeugt werden darf. Besonders die Ostukraine mit Odessa, Charkiw und Artjomowsk, dem heutigen Bachmut, steuern erhebliche Mengen bei. Laut EU-Recht muss jedoch zumindest ein Teil der Lagerung auf der Krim selbst stattgefunden haben. Allerdings dürfte er dann wiederum nicht in die EU eingeführt werden, weil Brüssel nach 2014 ein Embargo über die Halbinsel verhängte. Folglich handelt es sich bei allem, was aktuell in Deutschland zu erwerben ist, entweder um Restbestände aus der Zeit vor der Annexion – die aber schon sehr bald zur Neige gehen dürften – oder aber zumindest juristisch betrachtet nicht um Krimsekt. Text: Dario Sellmeier
Man kann angesichts des blutigen Krieges in der Ukraine durchaus die Frage stellen, ob solche Spitzfindigkeiten gerade angebracht sind. Dass aber mit Alkohol noch immer Politik gemacht wird, ist Tatsache: als Putin 2014 auf der gerade erst annektierten Krim Silvio Berlusconi empfing, besuchten beide das Weingut Massandra, gegründet Ende des 19. Jahrhunderts durch den uns schon bekannten Fürsten Golitzin für die Versorgung des Zaren, dessen Sommerresidenz Liwadija direkt nebenan lag. Die in den endlosen unterirdischen Stollen eingelagerten Schätze hatten sowohl zwei Weltkriege als auch die Revolution und den Stalinismus unbeschadet überstanden. Ausgerechnet aus der Privatsammlung des fortschrittlichen Krim-Förderers Woronzow wählten Putin und Berlusconi einen 200 Jahre alten Sherry, den sie sich medienwirksam einverleibten. Ob der ukrainische Staat als Eigentümer des Weingutes allerdings jemals die 80 000 Euro, welche die Flasche wert gewesen sein soll, zurückerhält, steht ebenso in den Sternen wie die Antwort auf die Frage, ob man in Deutschland demnächst einmal wieder echten Krimsekt trinken kann – oder ob der süße Geschmack nur eine schöne Erinnerung aus früheren Tagen bleiben wird.